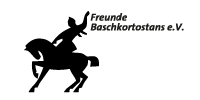Wer die Baschkiren treffen und ihre Traditionen erleben will, wird vor allem im Süden der Republik fündig.

Sabantui
Nachdem die Blechlawine aus Bajmak und Umgebung im Laufe des Vormittages auf einer großen Wiese zum Stehen gekommen ist, entsteigt ihr ein Ameisenhaufen von weit über tausend bunt gekleideten Menschen, in der Mehrzahl Baschkiren, und versammelt sich unter praller Sonne vor einer grünen Kulisse, die bis zum Horizont offen ist. Schon von weitem schallen einem durch voll aufgedrehte Lautsprecher verzerrte baschkirische Melodien entgegen. Manche davon erinnern den „Normal“-Europäer an fernöstliche, andere an keltische Harmonien. Man begeht den Sabantui, das jährliche Fest am frühsommerlichen Ende der Feldarbeiten. Dieses findet vielerorts auf dem Lande statt. Und im Süden Baschkortostans kann man sich bei solcher Gelegenheit davon überzeugen, dass die Baschkiren hier wirklich über die Hälfte der Bevölkerung stellen und auch baschkirisch sprechen, wie es sich gehört.
Die Traditionen, die man am Sabantui gezeigt bekommt, haben zwar mit dem heutigen Alltagsleben ähnlich viel gemein, wie die Bergparaden im Erzgebirge. Wer wohnt in Baschkirien schon noch in der Jurte? Dennoch sind diese Traditionen lebendig und werden von den Menschen zu allen möglichen repräsentativen Anlässen betrieben. (Hier sei angemerkt, dass es meine Mission in Ufa ist, die Menschen für das Bundesland Sachsen zu interessieren und es mir daher fern liegt, mich über die Einwohner des Erzgebirges lustig zu machen. Auch sie wohnen heute selbstverständlich in richtigen Häusern. Und ihre Traditionen werden ebenso gelebt. Da sei nur die TU Bergakademie Freiberg erwähnt, von deren Mitarbeitern man, sofern es sich um Einheimische der Region handelt, mit freundlichem „Glüggauf“ begrüßt wird.)
Zurück nach Bajmak. Auf einer großen Bühne treten in schnellem Wechsel verschiedene Tanzgruppen auf. Eine kleinere Bühne, auf der Kinder in schönen Trachten tanzen und singen, wird vom Lautsprecherbombardement leider hoffnungslos übertönt. Hinter ihnen steht die betagte Lehrerin, die mit ihnen wahrscheinlich Nachmittage lang geübt hat, und spielt mit strenger Miene Akkordeon, welches man nur im Umkreis von wenigen Metern hört.
Geht man weiter, so kann man verschiedene Wettkämpfe bestaunen – am wichtigsten sind Pferderennen, mit und ohne Kutsche, sowie der Ringkampf. Die mutige Öffentlichkeit darf auf einer Balancierstange laufen oder einen ca. 30m hohen Mast erklimmen, an dem diverse Geschenke hängen, darunter auch ein Hahn im Käfig. Der hat zu seiner Verängstigung allen Grund: Der Kletterer erwischt ihn, lässt ihn aber hinunterfallen; das ist unsportliches Verhalten. Wir gehen zu den Jurten, die in einer langen Reihe den Platz säumen. Um sie herum sind diverse Ausstellungen aufgebaut. Da findet man Holzkunst, baschkirischen Honig, ausgestopfte Vögel scheinen Pflicht, Fotos und Naturgemälde, Portraits von „Helden der sozialistischen Arbeit“ und „Helden der Sowjetunion“. Letztere sind jedoch nicht mit Namen versehen und blicken sehr emotionslos von der Wand, so dass ihnen wahrscheinlich niemand auf der Welt ähnlich sieht.
Die steppenartige Landschaft am Südende des Urals, wie auch die verzerrte Musik, die ausgestopften Tiere und die Jurten, wenngleich hier nur Museum, erinnerten mich an die Mongolei. Deshalb fiel mir gleich der mongolische Zagan Saar (Weisser Mond) ein, das wichtigste Fest der Mongolen. Dort werden auch Pferderennen und Ringkampf, neben Bogenschießen, als Nationalsportarten betrieben. Baschkirisch, was ja eine Turksprache ist, hat mit dem Mongolischen offenbar Gemeinsamkeiten. So heißt Batyr auch auf baschkirisch „Held“. Siehe Ulaan Baatar, der rote Recke, um wieder auf das Helden- und Vorbildtum zurückzukommen, welches ja in der ehemaligen Sowjetunion heute eine scheinbar unverändert große Rolle spielt.

Ausstellungsstend
Die Moschee von Baimak fand ich nur geschlossen vor und Gebetsrufe, wie in arabischen Ländern erschallen von ihrem Turm auch nicht. Die scheinen in Baschkirien nicht üblich zu sein. Eben lese ich, die „russischen“ Soldaten, die, Napoleon heimjagend, 1812 durch Weimar kamen, waren muslimische Baschkiren. (Anm.d.Red.: Nur ein Regiment besagter Soldaten bestand aus Baschkiren) J.W.v.Goethe besuchte einige ihrer Gottesdienste und war so beeindruckt, dass er sich darin vertiefte, so entstand sein „West-Östlicher Diwan“, in dem er Orient und Okzident zusammenzuführen suchte.
Von Bajmak findet Ihr schon einen früheren Bericht in Baschkirien-heute. Das Vergnügen der Besichtigung des Krankenhauses von innen blieb mir jedoch erspart, und ich wollte es auch nicht unbedingt darauf anlegen. Hierher gelangte ich durch das Glück, kurz nach meiner Ankunft in Ufa in einer WG mit zwei richtigen Baschkirinnen vorübergehend Asyl zu finden. Letztere heissen Mariam und Alfia, sind Schwestern und luden mich zu sich nach Hause ein. Wir besuchten den Sabantui und dann fuhr uns Ahmed, der Vater der beiden, im russischen Jeep durch die Gegend und an einen klaren und vor allem mückenfreien See zum Wandern und Fische braten. Er interessiert sich sehr für Deutschland und meint, die Russen würden über alles zu lange nachdenken, bevor sie sich entschliessen, deswegen bewege sich nichts. Das sei nun mal bei den „Germanen“ anders und ich darf ihm nicht widersprechen.
Einen Rundumblick über Bajmak hinaus, den ich mir kurz vor der Rückfahrt nach Ufa einschließlich Sonnenaufgang nicht entgehen ließ, hat man von der etwas entfernten Hügelkette, auf dem ein Fernsehmast steht. Die Gegend besteht hauptsächlich aus grünen metamorphen Gesteinen, die alle Nord-Süd, also in Richtung des Urals, aufgereiht sind. Über die Geologie, da sie mein Fach ist, will ich demnächst schreiben, wenn ich etwas mehr vom Ural gesehen habe. Hier sei nur gesagt, dass es an Erzen und anderen Bodenschätzen bekanntlich noch viel zu holen gibt: Wenn man bei uns in der Klausur über Lagerstätten kein Beispiel wusste, wo es den x-beliebigen Rohstoff gibt, konnte man notfalls Ural sagen, das stimmte immer. Wenig von Baimak entfernt werden Massivsulfide abgebaut und Magnitogorsk liegt auch nicht weit. In kleinem Maßstab findet man die Überreste individuellen Goldbergbaues in ehemaligen Flusssedimenten. Von dem Kleinbergbau sind Rinnen übriggeblieben, die geradlinig an den Hügeln entlanglaufen. Von hier haben die Leute den Sand einige hundert Meter zum Fluss geschleppt, um das Gold zu waschen, sofern es welches gab, weiss Ahmed. Das wurde dann auch staatlich betrieben, bis man der starken Strahlung gewahr wurde. Denn in den Sedimenten ist auch viel Uran angereichert, welches man beim Bergbau zwangsläufig freischaufelt. Die Rinnen der kleinen Goldgräber sind schon etwas zugewachsen, aber ich würde nicht ausschließen, dass manche auch heute ihr Glück versuchen.
Der grüne Platz ist inzwischen leer, die Autos, die sich unter der Sonne in Banjas verwandelt hatten, verschwunden und der in den Büschen liegende Müll will entsorgt werden. In der Kleinstadt wird es Abend und die Jugend geht in die Disko oder macht am Spirituosenladen Station, Babuschkas kehren vom Kartoffelgarten in die Holzhäuser zurück und legen Birkenzweige in die tatsächliche Banja.
Peter Bock